Das Internet war einst ein Versprechen – ein Ort des Austauschs, der kreativen Vielfalt, ein digitaler Marktplatz der Ideen. Doch in den letzten Jahren hat sich ein Gefühl eingeschlichen, das viele Nutzer nicht mehr loslässt: Irgendetwas hat sich verändert. Beiträge wirken seelenlos, Kommentare gleichen einander, Diskussionen verlaufen in vorgefertigten Bahnen. Dieses diffuse Unbehagen verdichtet sich in einer beunruhigenden Theorie: dem "Dead Internet"-Phänomen.
Diese Theorie behauptet, dass große Teile des Internets nicht mehr von echten Menschen, sondern von Künstlicher Intelligenz und Bots bevölkert werden. Was wie eine Verschwörung klingt, erhält durch reale Entwicklungen im digitalen Raum zunehmend Nahrung. KI-generierte Texte, Deepfakes, automatisierte Kommentare, Bot-Netzwerke – das Internet wird synthetisch. Und mit dieser Entwicklung wächst der Druck auf unsere Fähigkeit, echte von künstlichen Inhalten zu unterscheiden. Medienkompetenz, wie wir sie kennen, steht damit vor einer epochalen Herausforderung.
Medienkompetenz bedeutete lange Zeit, Informationen kritisch zu hinterfragen, Quellen zu prüfen, Inhalte zu verstehen und eigene Beiträge verantwortungsvoll zu gestalten. In einer Welt aber, in der nicht mehr klar ist, ob ein Text von einem Menschen oder einer Maschine stammt, ein Foto real oder KI-generiert ist, gerät dieses Verständnis an seine Grenzen. Der Nutzer sieht sich plötzlich mit Inhalten konfrontiert, die nicht nur manipulativ, sondern schlichtweg fiktiv sind – perfekt simuliert, aber ohne jeden realen Ursprung.
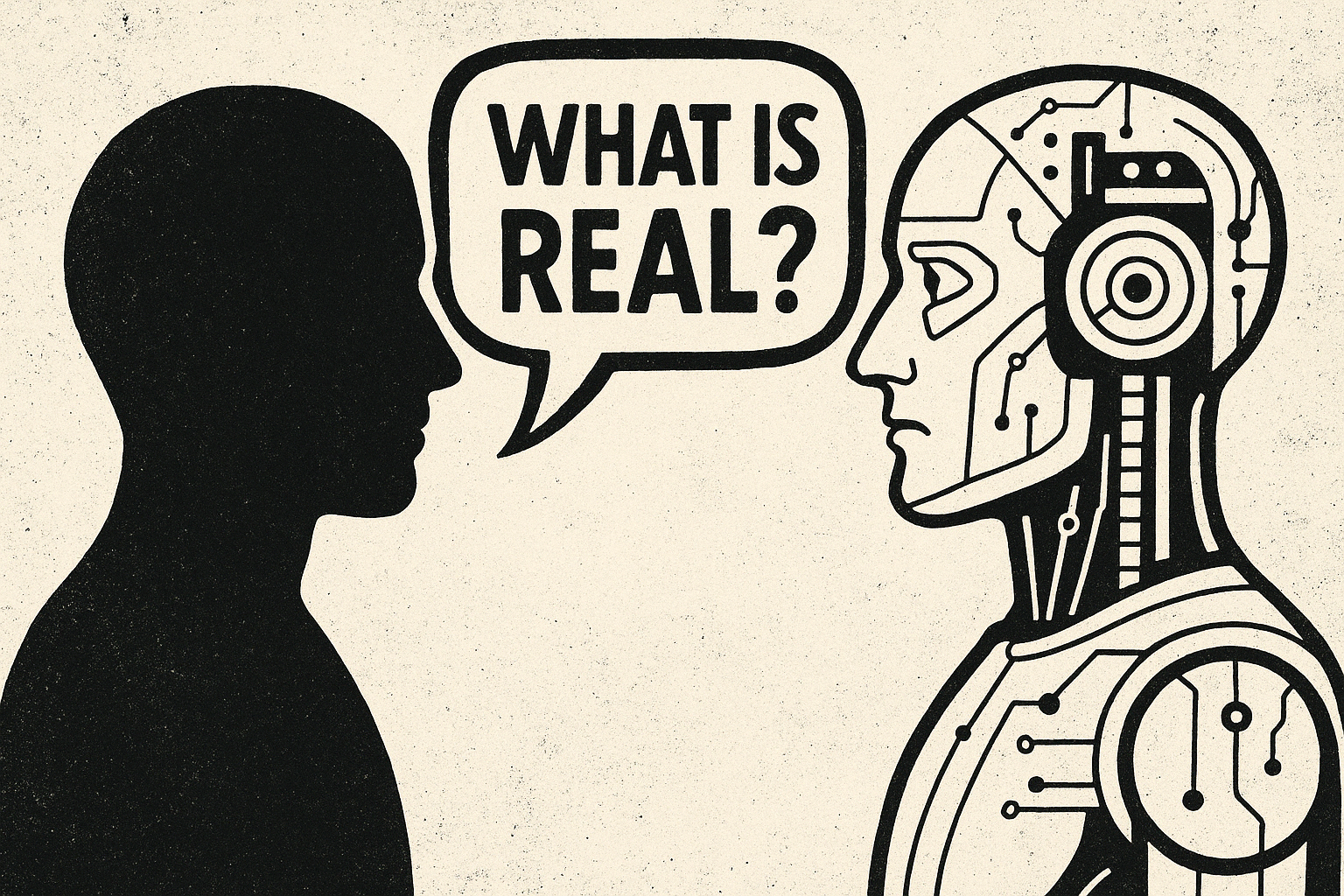
Die "Dead Internet"-Theorie, so umstritten sie sein mag, berührt damit einen wunden Punkt. Bereits 2016 stammte laut Studien mehr als die Hälfte des weltweiten Internet-Traffics von Bots. Dieser Trend hat sich verstetigt. Unternehmen wie Google oder Meta berichten von Fluten an inhaltsarmen Webseiten, die nur zu SEO-Zwecken von KIs erstellt werden. Likes und Kommentare in sozialen Netzwerken sind zunehmend automatisiert. Was bleibt vom ursprünglichen Gedanken des Internets, wenn echte Interaktion durch simulierte ersetzt wird?
Für den Einzelnen bedeutet das: Vertrauen wird zur Mangelware. Viele Nutzer begegnen Online-Inhalten heute mit Skepsis. Sie ziehen sich in kleinere, geschlossene Gruppen zurück, meiden offene Plattformen oder konsumieren nur noch passiv. Andere wiederum entwickeln neue Strategien – sie überprüfen Metadaten, hinterfragen die Quellenlage, nutzen Tools zur Erkennung von Fakes. Es entsteht eine neue Form der digitalen Wachsamkeit. Doch dieser Mehraufwand zehrt an den Kräften und verändert das Nutzerverhalten nachhaltig.
Gleichzeitig stellt sich eine philosophische Frage: Was bedeutet "Echtheit" überhaupt noch? Der französische Soziologe Jean Baudrillard schrieb: "Das Simulakrum ist wahr." Wenn eine KI einen Menschen perfekt imitiert – Stimme, Mimik, Ausdruck – was unterscheidet dann die Simulation noch vom Original? Und spielt das überhaupt eine Rolle, wenn der Effekt identisch ist?
Tatsächlich könnte Echtheit in einer Welt voll Fakes zum neuen Luxusgut werden. Digitale Wasserzeichen, Herkunftsnachweise, verifizierte Profile: All das könnte helfen, Authentizität wieder sichtbar zu machen. Plattformen könnten verpflichtet werden, KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen. Neue technische Standards wie C2PA arbeiten bereits daran, die Herkunft und Bearbeitung von Inhalten nachvollziehbar zu machen. Solche Entwicklungen sind essenziell, wenn wir das Internet als vertrauenswürdigen Raum erhalten wollen.

Doch Technik allein reicht nicht. Es braucht Bildung – und zwar auf allen Ebenen. Medienkompetenz muss bereits in Schulen als Schlüsselkompetenz vermittelt werden. Erwachsene brauchen niederschwellige Angebote zur Aufklärung über KI, Deepfakes und Desinformation. Öffentliche Kampagnen können sensibilisieren, wie man Falschinformationen erkennt und mit Unsicherheit umgeht. Gleichzeitig muss eine Kultur des kritischen Denkens gestärkt werden, die auch Ambiguität aushält – denn nicht alles lässt sich immer sofort eindeutig einordnen.
Gesellschaftlich stellt sich die Aufgabe, Räume für echte Kommunikation zu erhalten. Journalismus, der sich der Wahrheit verpflichtet, Communitys mit klaren Regeln, Plattformen mit Verantwortung – all das sind Bausteine für ein Internet, das nicht in der Simulation versinkt. Die Verantwortung liegt bei Entwicklern, Plattformbetreibern, Gesetzgebern – aber auch bei jedem Einzelnen.
Das "Dead Internet" mag keine wissenschaftlich belegbare Realität sein – doch es ist ein Bild, das unsere Ängste und Herausforderungen treffend zusammenfasst. Es mahnt uns, nicht naiv in eine Welt digitaler Spiegelbilder zu driften, sondern aktiv die Fähigkeit zu bewahren und weiterzuentwickeln, Wahrheit von Täuschung zu unterscheiden.
Denn am Ende ist das Internet nicht einfach da – es ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, ein Werkzeug unserer Kommunikation, ein Raum unseres Denkens. Und wie dieser Raum aussieht, entscheiden wir selbst. Medienkompetenz ist dabei nicht nur ein Skill. Sie ist unser Schutzschild, unser Kompass – und vielleicht unsere letzte Verbindung zur Wirklichkeit.
"Nicht die KI ist das Problem, sondern unsere Unfähigkeit, sie einzuordnen." Dieser Satz bringt es auf den Punkt. Wenn wir Medienkompetenz neu denken, können wir auch in einer simulierten Welt echte Begegnungen ermöglichen. Und damit das Internet retten – vor dem digitalen Tod durch Gleichförmigkeit und künstliche Illusion.
Denn letztlich gilt: Das Internet ist, was wir daraus machen.

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat und du mehr über digitale Wahrheiten, künstliche Intelligenz und die Zukunft unserer Medienwelt erfahren möchtest – dann klick dich weiter durch die Sternen Schmiede. Hier warten noch viele Gedanken, Geschichten und Visionen aus den Weiten des Internets und des Alls.

Matt McKenzie
Sternenwanderer, Wortschmied – Matt McKenzie erkundet die Grenzen des Vorstellbaren und schreibt darüber, als wäre er mittendrin. Fantasie trifft Technik in der Sternen Schmiede.
Folge mir :











Leave a Comment