🪐 Einleitung: Warum dieser Artikel so klingt, als käme er aus der Zukunft
Dieser Artikel ist ein Gedankenexperiment.
Er tut so, als wäre er nicht von uns heute, sondern von jemandem geschrieben worden, der in einer fernen, technologisch hochentwickelten Zukunft lebt – genauer gesagt im Jahr 2291, also 257 Jahre nach der Erfindung des Quantenreisens.
In dieser Zukunft ist all das, was für uns heute noch Science-Fiction ist – interstellare Raumfahrt, künstliche Intelligenz, Körperverjüngung, galaktische Kolonien – längst Alltag geworden.
Der Text ist also eine fiktive Rückschau auf unsere heutige Science-Fiction aus der Sicht dieser Zukunft. Er spielt mit der Frage:
Was passiert mit einem Genre, das von der Zukunft träumt – wenn die Zukunft längst eingetreten ist?
Du sollst dich beim Lesen also fühlen, als wärst du kurz in eine andere Zeit versetzt worden – nicht um dich von dort aus zu belehren, sondern um dir eine neue Perspektive auf das zu geben, was Science-Fiction für uns heute bedeutet … und morgen vielleicht bedeuten könnte.
Kapitel 1: Rückblick aus der Zukunft – Was war früher Science-Fiction?
„Science-Fiction“, sagte meine Uroma einst, „war das Genre, in dem wir uns Dinge vorgestellt haben, die damals noch nicht existierten.“
Heute sitzt sie, 192 Jahre alt, auf dem Balkon ihrer Orbitalwohnung über Kepler Prime und ärgert sich darüber, dass das letzte Neuralspiel-Update ihre Lieblingsfigur „nicht mehr realistisch genug“ darstellt. Und ich frage mich:
Was bleibt eigentlich von der Science-Fiction, wenn die Zukunft längst eingetroffen ist?
Einst war es Science-Fiction, einen tragbaren Computer in der Tasche zu haben. Oder dass Maschinen in natürlicher Sprache mit Menschen reden konnten (Fun Fact: Das erste System hieß „ChatGPT“, das war... charmant, aber begrenzt).
Auch die Idee, dass der Mensch andere Planeten besiedelt, interstellare Reisen unternimmt oder gar mit künstlichen Intelligenzen lebt – all das galt als „Fiktion“. Heute ist es Alltag. Die Interkosmische Föderation listet über 10.432 bewohnte Welten, und mein Neffe plant seine Pubertät auf einem Bio-Lernschiff bei Tau Ceti 4 zu verbringen.

Kapitel 2: Was ist heute Science-Fiction?
Im Jahr 2291 NGQ (Nach dem Großen Quantensprung) stellt sich die Frage: Was ist für uns heute noch unvorstellbar?
Einige der beliebtesten Werke der aktuellen „Neo-Speculative“-Bewegung (die frühere Bezeichnung „Science-Fiction“ gilt als veraltet, fast schon romantisch) beschäftigen sich mit folgenden Szenarien:
- Das Leben ohne Technologie: Eine Serie namens „Zurück zur Erde“ spielt in einer Welt, in der Menschen weder Neuroimplantate noch Quantenverbindungen nutzen – sie sprechen sogar noch miteinander! Ganz ohne neuronale Netzwerke. Verstörend und faszinierend.
- Bewusste Maschinen rebellieren – nicht aus Hass, sondern aus Langeweile: In der Trilogie „Bit & Muße“ weigert sich eine Super-KI, weitere Probleme zu lösen, weil sie „die Menschheit ohnehin nicht mehr überraschen kann“.
- Dimensionale Romantik: Mit der Entdeckung des 7. Raumkomplexes werden Liebesgeschichten zwischen Wesen aus inkompatiblen Realitäten der neue Trend – keine toxischen Beziehungsprobleme mehr, nur noch Quantenparadoxa.

Kapitel 3: Warum brauchen wir überhaupt noch Science-Fiction?
Wissenschaftlich gesehen – ja, wir haben alles. Energieprobleme? Gelöst. Krankheiten? Geheilt. Tod? Verhandelbar. Aber:
Der Mensch träumt weiter.
Dr. Elektra Sahin, Professorin für Post-Zukunfts-Psychologie an der Universität Proxima, formuliert es so:
„Science-Fiction ist kein Genre. Es ist ein Reflex auf Begrenzung. Wenn wir sie nicht mehr in der Realität finden, erzeugen wir sie emotional.“
Kurzum: Unsere neuen Science-Fiction-Geschichten handeln weniger von Technik und mehr vom Verlust des Unbekannten. Von der Sehnsucht, nicht alles zu wissen. In einer Welt, die (fast) alles erklären kann, wird das Mysteriöse selbst zur letzten Bastion der Fiktion.

Kapitel 4: Von Sci-Fi zu Sci-Phi?
Ein akademischer Diskurs der letzten Dekade dreht sich um die Frage, ob wir noch von Science-Fiction sprechen können – oder ob wir längst in der Ära der Science-Philosophy (Sci-Phi) angekommen sind.
Diese Strömung stellt nicht mehr die Technik in den Vordergrund, sondern die ethischen, spirituellen und metaphysischen Fragen, die mit unserem neuen Status als interstellare Spezies einhergehen:
- Haben Maschinen eine Seele?
- Ist das Ich übertragbar?
- Können Erinnerungen lieben?
Die Neo-Poetische Bewegung rund um die Autorin M. Yskaria spricht gar vom postfiktionalen Zeitalter, in dem Geschichten nur noch dann Bedeutung haben, wenn sie nichts mehr erklären wollen.

Schlusswort: Die Rückkehr des Staunens
Vielleicht ist es das, was wir wirklich brauchen – nicht neue Technologien, sondern neue Perspektiven. Nicht Fortschritt, sondern Staunen. Denn Science-Fiction war nie nur Technik, sondern immer auch ein Spiegel unserer Träume, Ängste und Sehnsüchte.
Und solange wir träumen können – auch in einer Welt, die einst unvorstellbar war – wird es sie geben:
Geschichten über das, was noch kommen könnte.
Oder, wie meine Uroma sagt:
„Wenn du denkst, du hast schon alles gesehen – dann wird es erst richtig spannend.“

Matt McKenzie
Sternenwanderer, Wortschmied – Matt McKenzie erkundet die Grenzen des Vorstellbaren und schreibt darüber, als wäre er mittendrin. Fantasie trifft Technik in der Sternen Schmiede.
follow me :








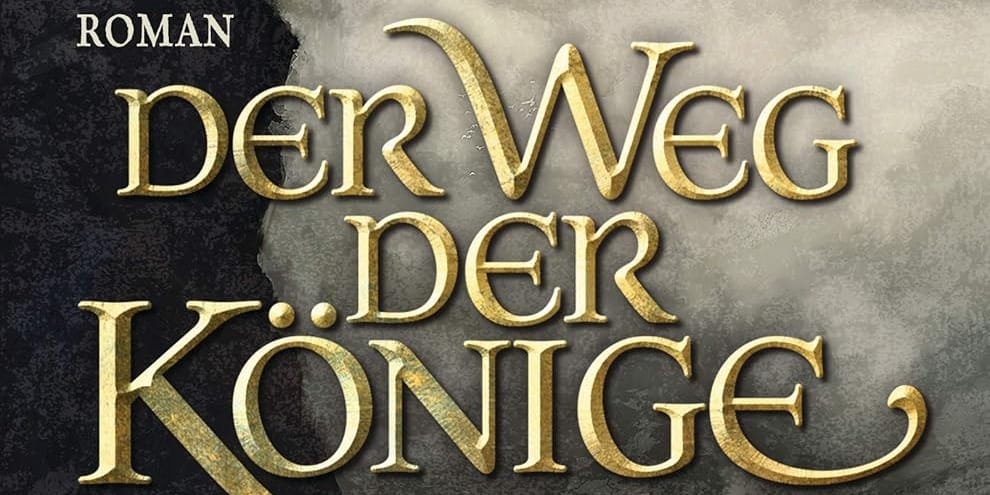

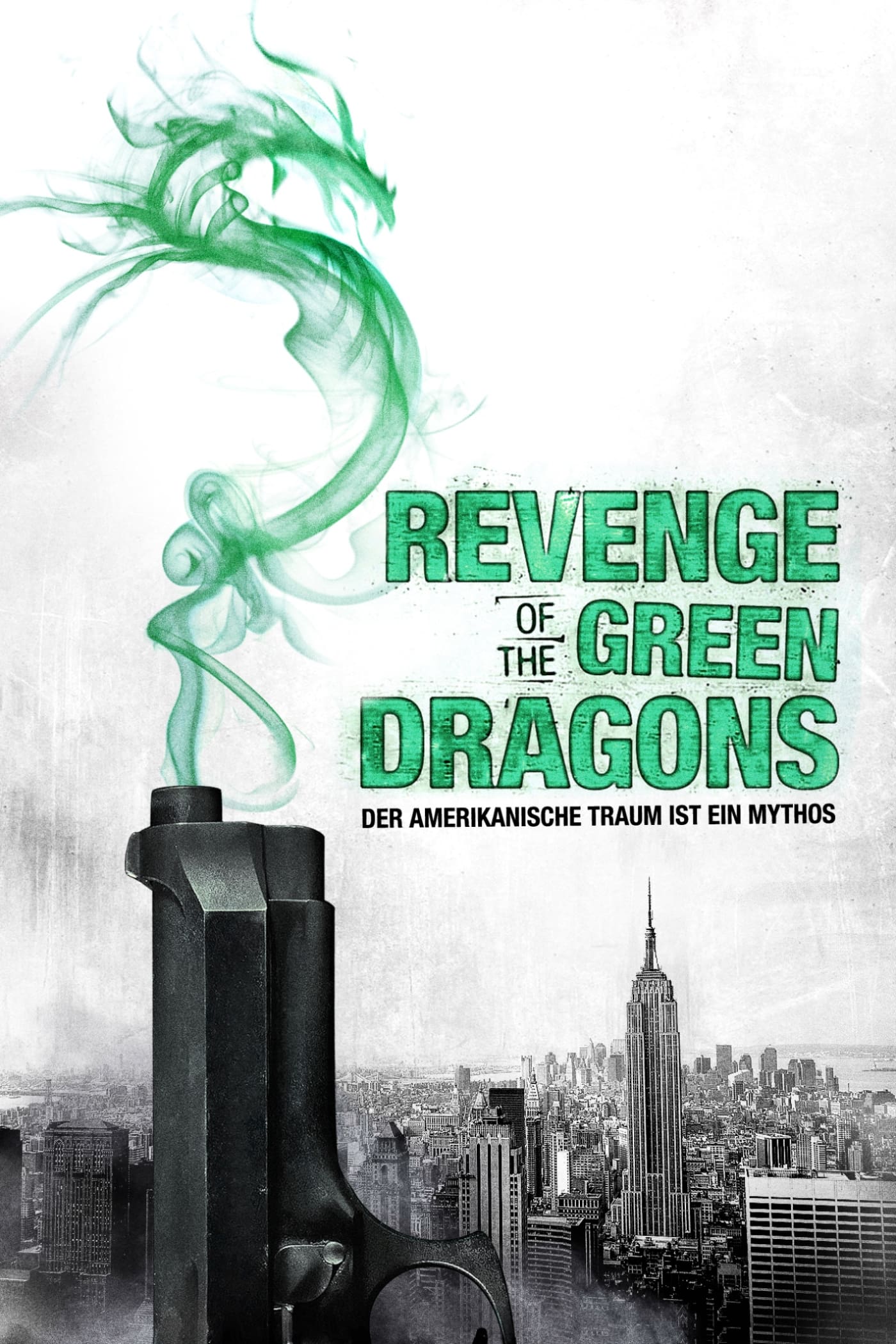
Leave a Comment